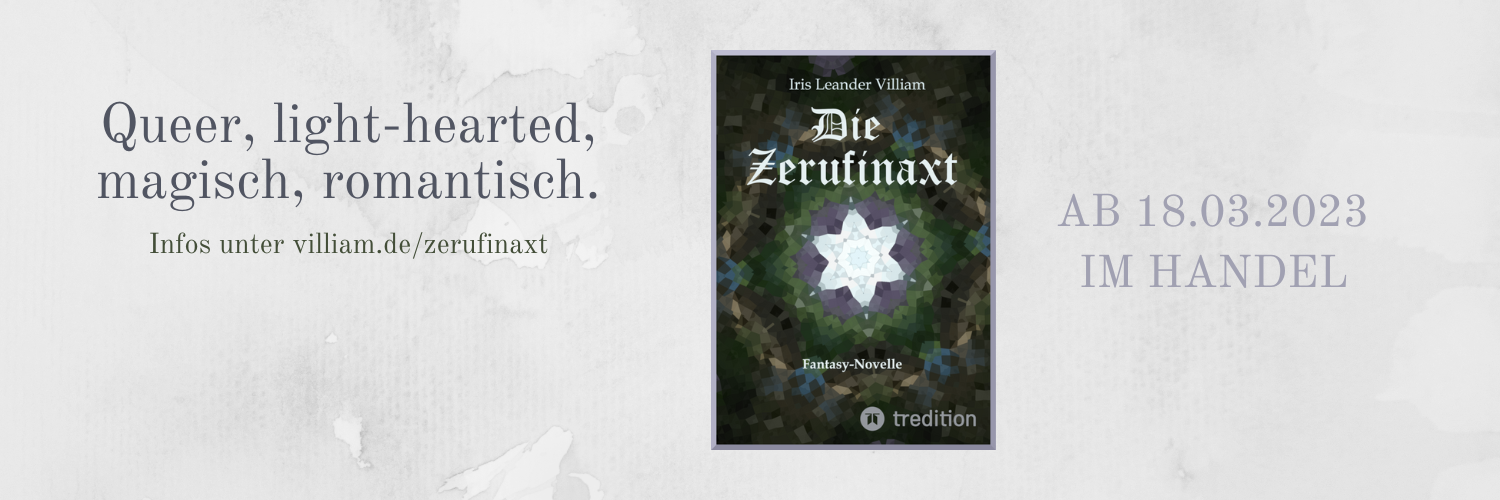Mist
Habe leider aus Versehen meine komplette Website gelöscht. Kann dauern, bis ich dazu komme, hier was neues zu erstellen. Bis dahin guckt gern hier: ko-fi.com/villiam oder https://belletristica.com/de/users/20492-leander-villiam oder besucht mich unter @drude@literatur.social auf Mastodon.